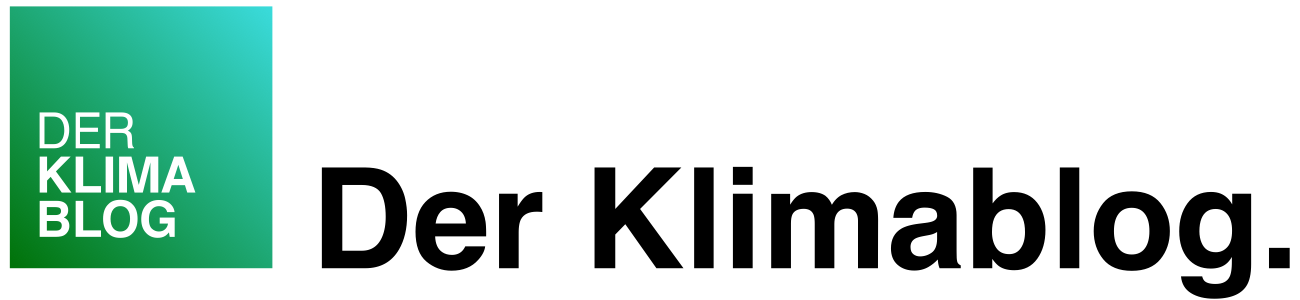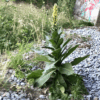Noch ist es nicht vorbei. Der unfassbare Gletschersturz in der Schweiz beschäftigt. Was ist passiert, wer berichtet und wie wird berichtet? Warum halten sich die ARD und das Schweizer Fernsehen zurück, während viele internationale Medien den Zusammenhang mit dem Klimawandel deutlich machen? In welcher Krise steckt der Mediensektor und wie wirkt sich das auf die Klimaberichterstattung aus? Wie steht es um diese überhaupt? Welche ethischen Fragen tun sich dabei auf? Viele Fragen und die Suche nach ebenso vielen Antworten. Herzlich willkommen.
Um was geht es?
DerKlimablog hat schon einmal bei diesem Fall beleuchtet, dass Medien unter immer mehr Druck der sich zuspitzenden Medienökonomie der Medienkrise mitunter seltsame Praktiken an den Tag legen. Was gut geklickt wird, wird verstärkt. Wichtiger Kontext verschwindet hinter der Paywall und eine ausgewogene Berichterstattung wird über verschiedene Kanäle und Zielgruppen hinweg fragmentiert. Das hat Folgen für die Wahrnehmung, Meinungsbildung und damit auch für die Demokratie. Besonders bei der Klimakatastrophe sind solche Veränderungen im hyperschnellen digitalen Journalismus besonders gefährlich – geht es doch ums nackte Überleben von uns allen. Gut informiert sein, ist nicht mehr für alle und überall selbstverständlich. Die Restglut am Lagerfeuer der Tagesschauen landauf und ab stinkt ziemlich ungesund. Am Beispiel des Gletschersturzes in der Schweiz kann man viele Dinge der spätkapitalistischen und immer öfter postfaktischen Zeit der Klimakrise gut beschreiben. Let’s go:

Was ist passiert?
Vor zwei Tagen ist es noch schlimmer gekommen, als alle gedacht haben. In der Schweiz im südlichen und zweisprachigen Kanton Wallis ist im Seitental namens Lötschental oberhalb des Dorfes Blatten ein Teil der Bergspitze des Nesthorns abgebrochen und auf den darunterliegenden Birchgletscher gefallen. Dieser wiederum ist unter dem Gewicht der Gesteinsmasse abgebrochen und mit dieser zusammen in einer Geröll- und Eislawine ins Tal gestürzt. Das Dorf wurde vollständig zerstört. Dabei wird nun der Fluss des Tales gestaut, ein See hat sich gebildet und verschluckt auch noch die letzten erhaltenen Gebäude. Der See könnte ausbrechen und eine Flutwelle würde dann das ganze Tal mit allen Ortschaften sowie viel weiter unten auch das Rohnetal mit weiteren Siedlungen bedrohen. Leider sagt der Wetterbericht punktgenau im Lötschental die nächsten Tage Starkregenereignisse vorher. Ein Mann wird vermisst, 300 Bewohner von Blatten wurden rechtzeitig evakuiert, haben aber alles verloren. Sie werden psychologisch betreut. Weitere 365 Menschen mussten weiter unten vorübergehend ihre Häuser verlassen. Man geht momentan davon aus, dass mehrere hundert Millionen an Schaden entstanden sind. Dass der Klimawandel mit dem Ereignis so einiges zu tun hat, steht eigentlich außer Frage. Aber dazu gleich mehr.
Was wird berichtet?
Wichtig hierbei ist, wann genau berichtet wird, wen das wo erreicht und wen eben nicht. Darum geht es in diesem Beitrag. Als Erstes fiel auf, dass renommierte Medien wie BBC, ORF, ZDF, Frankfurter Rundschau, Guardian und weitere in ihren ersten Berichterstattungen direkt den Kontext des Klimawandels erwähnt haben. Somit war für deren Leser und Zuschauer von Anfang an klar, wie sie die Geschehnisse in der Schweiz einordnen. Seltsamerweise war das aber gerade bei den wichtigsten Formaten mit den meisten Zuschauern beim Schweizer Fernsehen SRF und bei der ARD nicht so. In deren Ausgaben der jeweiligen Tagesschauen zur Hauptsendezeit und in den Spätausgaben wurde der Zusammenhang mit der Klimaerwärmung nicht mit einem Sterbenswörtchen erwähnt – weder am Tag des Ereignisses selber, noch am Folgetag. Ist es ein Zufall, dass beide öffentlich-rechtlichen Medienhäuser gerade stark unter politischem Druck stehen? In der Schweiz möchte die konservative rechte Partei SVP mit der sogenannten „Halbierungsinitiative“ per Volksentscheid das jährliche Budget vom öffentlichen Rundfunk halbieren. Auch in Deutschland möchte die konservative CDU den ÖRR momentan „reformieren“. Dabei wurden diese Institutionen ursprünglich genau zu dem Zweck gegründet, dass sie unabhängig von Politik als vierte Gewalt die Demokratie verteidigen und neutral berichten. Wie zum Teufel konnte es so weit kommen? Dazu gleich mehr.
Nun ist es aber nicht so, dass sie Klima gar nicht erwähnt hätten. SRF tat dies aber erst auf ihrer Plattform für Ausländer, die in etwa der Deutschen Welle gleichkommt. Im Hauptprogramm ließ sie derweil einen Glaziologen zu Worte kommen, der den Klimawandel zwar erwähnte, jedoch von einem reinen Zufallsereignis sprach und einen direkte Zusammenhang verneinte. Die Tagesschau der ARD hat den Gletschersturz nicht mit dem Klima in Verbindung gebracht und ihm nur ca. 25 Sekunden gewidmet. Aber zuvor im selben 3-Minutenblock die gescheiterte Klage des peruanischen Bauern gebracht, welcher gegen RWE geklagt hatte, dass wenn der Gletscher hinter seinem Haus schmelze, sein Haus betroffen sein werde – und verlor, mit der Begründung, ein Computermodell sage, dass das Wasser im Haus bei Flut ja nur 20 cm hoch stehen würde und daher kein Totalschaden entstehe. Daran angehängt kam die Meldung, dass die UN vor den immer stärker ansteigenden Temperaturen und ihren Folgen warnt. Die ARD hat also geschickt Klimameldungen davor gepackt, damit der findige Zuschauer sehr wohl einen Zusammenhang dieser Meldungen vermuten könnte – wenn er das denn freiwillig will oder intellektuell kann. Etwas bizarr und es sieht aus, wie wenn da Journalisten eine Art passiven Widerstand leisten, weil sie das Wort Klimakatastrophe nicht sagen dürfen.
In den Tagen danach ordneten viele Experten weltweit das schreckliche Ergebnis in seiner geschehenen Form klar und deutlich so ein, dass der Klimawandel einen erheblichen Anteil daran hat. Konkret ist es so, dass der Permafrost in höheren Lagen immer stärker auftaut und damit die Bergspitzen nicht mehr zusammenhalten. Die Folgen wurden von der Wissenschaft vorhergesagt, die Alpen erwärmen sich zweimal so schnell wie der Weltdurchschnitt.
Auch die Tagesschau wagte mehr und stellte in einem Beitrag auf ihrer Webseite die Frage, ob der Klimawandel einen Anteil haben könne – worauf ein Wissenschaftler zu Wort kam und korrekt antwortete, dass es komplex sei. Aber alleine die suggestive Frage als Titel (der Bayrische Rundfunk fragt sogar „Liegt es wirklich am Klimawandel?“), welche Interpretationsspielraum lässt, dass das alles noch infrage stehe, ist irgendwie sehr schräg. In der Schweiz wiederum erklärte der Experte der Hochschule ETH dem SRF im Detail, die Schweiz habe die besten Messgeräte weltweit und mehr Geld als alle anderen, um sich in der Situation zu helfen. Lob gibt es für die Behörden. Er sagt aber entscheidend: „Man kann sicher nicht direkt sagen, der Klimawandel ist verantwortlich dafür, dass dieses Ereignis jetzt passiert ist.“. Nun, es hat ja auch niemand direkt nach dem Unglück stichfeste empirische Evidenz auf diesen Einzelfall bezogen gefordert. Aber durch diese Art der Berichterstattung und auf die Weise, wie etwas gesagt wird, wird subjektiv der Kontext der Klimakatastrophe verklärt oder ganz weggelassen und für Ungeübte kann das dann sogar wie eine Negierung klingen.
Wenn man genauer hinschaut, ist es so, dass durch eine zufällige Entdeckung von herunter kullernden Steinen überhaupt Vorgänge am Berg bemerkt wurden. Zum Glück rechtzeitig, aber erst daraufhin wurde der Berg systematisch überwacht und der Ort darunter schlussendlich evakuiert. Es ist nicht möglich, alle Gefahren und Orte zu überwachen. Ein Mann starb in der Zone, die nicht evakuiert werden sollte. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. Das Ereignis ist zudem nicht das Einzige. Auch beim kürzlichen Bergsturz von Bondo, welcher ebenfalls Ortschaft und Menschen verschlang, dem drohenden Bergsturz in Kandersteg oder dem Bergsturz von Brienz, spielt das Klima mehr oder weniger eine tragende Rolle. Bei letzterem wird das übrigens medial ebenfalls lokal verneint. Allerdings sagen das Geologen vor der Kamera, die nur die direkten vor Ort wirkenden Mechanismen von Wasser und Gestein erklären. Geologen sind aber keine Klimatologen. Dass der Ort endgültig evakuiert und praktisch aufgegeben wurde, nachdem letztes Jahr außergewöhnlich starke Regenfälle die Region (und auch mit verheerenden Folgen das Wallis, wo Blatten liegt) traf, welche wiederum mit den aktuell sehr hohen Ozeantemperaturen als Folge der Erderwärmung zusammenhängen, ist eben doch auch Teil der Story. Dass Bergstürze, Gletsherabbrüche, Hitzewellen und Starkregen zunehmen, ebenfalls. Das zu vernetzen, ist journalistische Verantwortung. Es einfach wegzulassen, fahrlässig.
Der ÖRR und das Klima
Grundsätzlich könnte man erwarten, dass Medien und gerade der öffentliche Rundfunk die Themenschwerpunkte so setzen, dass sie in der Berichterstattung entsprechend ihrer Priorität und ihrem Impact entsprechend häufig im Programm erwähnt werden – und zwar dann, wenn am meisten Menschen erreicht werden. Doch verschiedene Studien bescheinigen, dass das Thema Klima viel zu kurz kommt und nicht angemessen berichtet wird. Die Universität Mainz sagt zum Beispiel konkret, dass Klima und Umwelt zusammen mit einem Anteil von 7 % im ÖRR vorkommen, Arbeit und Wirtschaft hingegen mit 31 %. Bei privaten Medien sieht das praktisch gleich aus. Wenn man die Akteure anschaut, die zu Wort kommen – dann sind das 11 % aus der Wirtschaft, aber nur 1,5 % für Klima und Umwelt. Genau diese Verteilung kritisiert die Organisation „Klima vor Acht“, die in einem offenen Brief von der ARD ein entsprechendes Format wünschte, welches vor der Tagesschau in wenigen Minuten jeweils die Geschehnisse rund um Klima berichten sollte – Folgen, Forschung, Menschen usw. Unterschrieben von unzähligen Größen aus Wissenschaft, Gesellschaft und dem Fernsehen selber – die angestellten Journalisten und Programmmacher haben also durchaus Bock und machen einen fantastischen Job, aber nur da, wo sie halt überhaupt dürfen. Die ARD lehnte aber ab und daraufhin setzte der private Sender RTL ein ähnliches Format um, welches donnerstags und samstags um 19.05 läuft und 60 Sekunden lang ist, einmal pro Monat sogar 15 Minuten. Es wurde 2022 für den Grimme-Award nominiert.
Medienkrise
Journalisten wollen, dürfen aber nicht, Politik nimmt Einfluss und hemmt den öffentlichen Rundfunk, was dessen Funktion ad absurdum führt. Ganz nebenbei haben wir ein immer größer werdendes Demokratieproblem. Das könnte einem schon Angst machen, vor allem, wenn man bedenkt, dass nur eine gut informierte Bevölkerung von der Politik genug Klimapolitik verlangen kann. Noch vor zwei Jahren fanden 70 % in Deutschland, dass die Politik mehr Klimaschutz machen sollte. Heute finden noch 54 % Umwelt- und Klimaschutz sehr wichtig. Weltweit stimmen hingegen 89 % mehr Klimaschutz zu. Vor allem in besonders betroffenen Regionen steigt dieser Wert überproportional.
Herkömmliche Medien befinden sich seit geraumer Zeit in einer Krise, oft Medienkrise genannt. Damit hat vor allem die Entwicklung des Internets zu tun. Digitale Multis wie Google und Meta saugen den klassischen Medien alle Werbegelder ab. Abonnentenzahlen sinken zeitweise zweistellig. Neue nonlineare Angebote und soziale Plattformen bekommen immer mehr Aufmerksamkeit, mit der Hilfe von auf Gewinn optimierten Algorithmen. Begleitet von schlimmen Nebeneffekten wie erodierende Demokratie, steigender Hass, Hetze, Queerfeindlichkeit oder Filterblasen, die mitunter Teenager bis in den Selbstmord treiben. Gerade Deutschland ist als digitales Neandertal besonders vulnerabel. Ein digital extrem rückständiges Bildungssystem, unzureichende digitale Infrastruktur wohin man schaut – die Lachnummer Europas. Das führt zu einer über weite Strecken fehlende digitale Kultur. Ganze Generationen, die nicht mit der Informationsflut des Informationszeitalters umgehen können.
Journalisten werden reihenweise entlassen, Sparprogramme beuteln große Medienhäuser und digitale Konzerne dringen aggressiv in den deutschen Markt ein. Auch innovative digitale Formate wie BuzzFeed oder Vice gingen pleite, weil sie von Big Tech ausgetrocknet wurden. Und die Internetgiganten lobbyieren ganz offen gegen mehr Regulierung, oft Hand in Hand mit Erdölkonzernen. Die meisten Medien können es sich auch nicht erlauben, klimaschädliche Werbung abzulehnen. Und dann eben noch der Druck von konservativer und ultrarechter Politik, die den ÖRR am liebsten abschaffen würde. Damit noch nicht genug, obendrauf kommen noch private Medienkonzerne wie Springer, der bis vor kurzem z.B. mit KKR einen Investor an Bord hatte, welcher stark in Erdölgeschäfte involviert ist. Mit unglaublicher Macht wurden Menschen Angst vor Wärmepumpen gemacht und Elektroautos schlechtgeredet, der Konzernchef per SMS im direkten Kontakt mit der abgestürzten FDP.

Warum lassen wir uns diese Zustände gefallen? Sie alle tragen dazu bei, dass die fossile Lobby weiterhin Medien, Politik und Zuschauer manipuliert. Wir erhalten kein gemeinsames (das berühmte Lagerfeuer) Bild mehr und schon gar kein der Situation angemessenes mehr. Die Folgen sind drastisch und schrecklich. Klimaschutz und politische Regulierung verzögern sich, werden verwässert – Menschen sterben.
Was hilft dagegen? Den ÖRR noch unabhängiger von der Politik machen. Ja, über die Zeit hat sich eine gewisse Fettleibigkeit bei den Öffentlichen breit gemacht – Skandale wie der RBB haben gar nicht geholfen. Aber unabhängige Medien sind unsere Lebensversicherung bei Klima und Demokratie. Vielleicht müssen Kosten besser oder fairer verteilt werden – und besser erklärt werden, warum jeder Cent für den ÖRR weiterhin wertvoll ist und dieser nicht hauptsächlich für Unterhaltung da ist. Viele vergleichen ja den persönlichen Wert mit völlig anderen Medienangeboten. Das ist nicht fair. Aus der Medienforschung kennt man, dass teure Exzellenz und billiger Bullshit wachsen, dazwischen sterben Angebote aus. Siehe Regionalzeitungen (z.B. gerade im Osten, wo dann unheilvolle Blätter der unsäglichen Blauen oft nur noch das einzige Angebot sind). Helfen könnte, wenn alle zusammenspannen. Man stelle sich vor, es gäbe eine Art Deutschlandticket für Meiden. 5 Euro im Monat für alles. Wenn man in jedem Verbund von Skigebieten und Fitnessstudios im Hintergrund die Nutzung digital nach Frequenz abrechnen kann, wieso dann nicht auch bei Medien? Weniger Konkurrenz – denn die wahre Gefahr sind die Techkonzerne aus den USA.
Medienkompetenz hätte einen eigenen Beitrag verdient – aber statt nur darüber zu reden, warum nicht ein nationales Institut gründen, welches in gigantischen Kampagnen die Bevölkerung auf Stand bringt? Wir sind bei Desinformation vulnerabel, Kräfte wie China, Russland usw. beeinflussen uns – das sagen Abgeordnete, der Geheimdienst, die Regierung und viele mehr. Es ist schlicht eine Notwendigkeit für die Sicherheit. Genau wie die Unabhängigkeit von Gas, welche uns nun Konservative und eben Trolle aus aller Welt ausreden wollen.
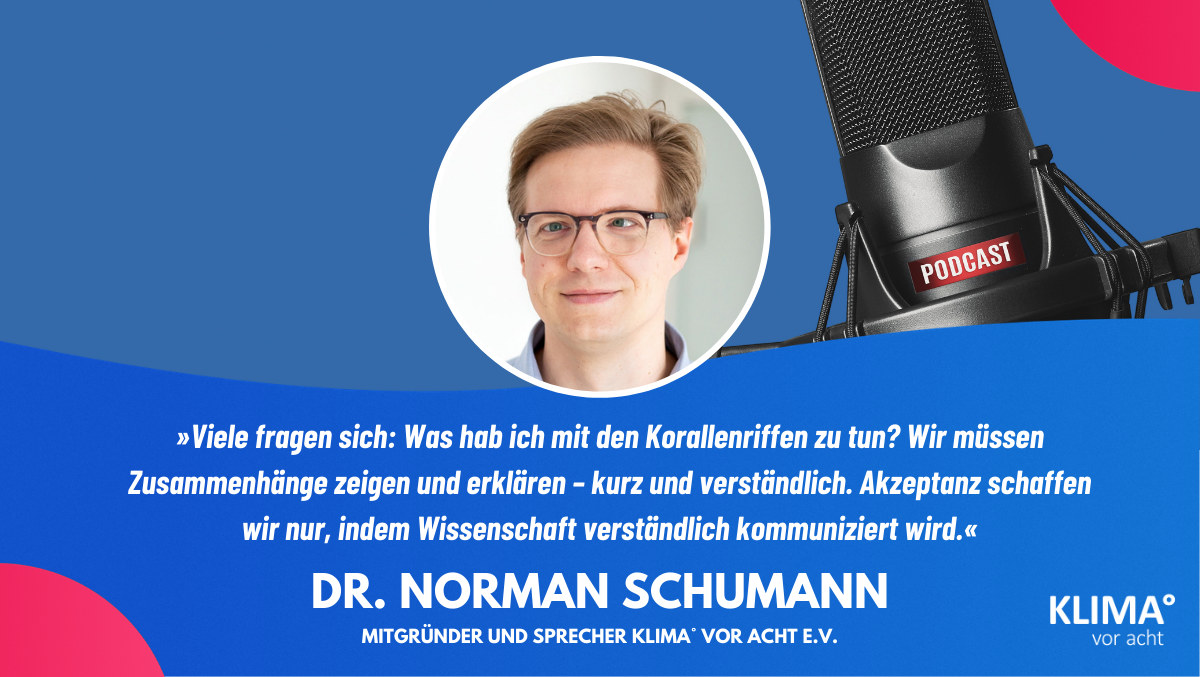
Bei den sozialen Medien könnte man gute Alternativen zu den immer schlechter gewordenen Marktführern fördern – mehr Vielfalt und damit Resilienz. Dass Kanzler Scholz nach dem Fall von Twitter erstmal peinlich Screenshots von den eigenen Tweets auf seiner Webseite stellte, zeigte, wie wenig das Problem verstanden hat. Er hätte in der Situation auch das in diesem Moment führende Mastodon aus Berlin unterstützen können – jetzt hat diese Rolle weitgehend das kommerzielle amerikanische Bluesky übernommen. Auch eine unabhängige Infrastruktur würde helfen. Diese Datenzentren könnte man dann direkt auch für eine gemeinsame europäische Lösung für öffentlich-rechtliche Mediatheken nutzen. Es gibt also viele Möglichkeiten, die Situation zu ändern. Die starke Regulation von sozialen Netzwerken, sodass diese nicht mehr tödlich und destruktiv wirken können, ist ebenfalls dringend angezeigt. An der führenden Digitalmesse Europas, der Re:Publica in Berlin, wurde über all das viel gesprochen. Wir könnten dabei weltweit mit Verbündeten zusammenarbeiten und unsere Beziehungen im Hinblick auf Medien und auch Klima damit stärken. Wir brauchen endlich Taten, nicht einen Kanzler, ja eine Regierung, welche in die fossile Vergangenheit zurückwollen.
Rezeption und Ethik
Warum ist es so wichtig, was wann, wo und wem berichtet wird? Es gibts so eine Annahme, dass wenn eine Information mal verfügbar ist, dass dann die viel besungene Eigenverantwortung greife. Natürlich steht die gesamte Klimakatastrophe ja bereits im Internet. Aber es spielt nun mal eine Rolle, ob zur Hauptsendezeit die größte Bevölkerungsgruppe millionenfach Zusammenhänge und Kontext korrekt erklärt bekommt, oder ob irgendwo im Spartenprogramm und auf hinteren Plattformen pro forma noch irgendwas verspätet geliefert und dabei noch ein bisschen angezweifelt wurde. Es ist zentral, die Aufmerksamkeit des Moments zu nutzen. Und es ist auch nicht pietätlos. Denn gleichzeitig, als die 300 Bewohner von Blatten alles verloren, wurden in Kanada 17.000 Menschen vor gigantischen Feuern evakuiert und 50.000 Menschen in Australien waren von der Außenwelt abgeschnitten, weil sie die schlimmste Flutkatastrophe seit 500 Jahren heimsuchte – die zweite innerhalb weniger Wochen. Rund um den Globus sterben Menschen und verlieren Tausende alles. Tag für Tag. DerKlimablog versucht das hier zu dokumentieren und festzuhalten. Das macht zwar das Leid der 300 in der Schweiz nicht kleiner, aber es zeigt auf, dass sie ein Teil von noch viel, viel mehr sind. Paradoxerweise wissen viele der Blattner nichts von peruanischen Bauern mit denselben Sorgen oder haben von Kanada und Australien nichts mitbekommen. Die Frage ist, warum. Und die Frage ist zentral, denn von der Rezeption der Mehrheit hängt ab, wie sie die Politik in Realität und Zukunft davor schützt, wie Forschungsgelder verteilt werden und welche Argumente sie haben werden, wenn sie mit Versicherungen vor Gericht ziehen müssen. Denn im Kanton Wallis gibt es keine Pflicht für eine Gebäudeversicherung auf Elementarschäden – und wenn man eine hat, sind Ereignisse wie der Gletschersturz oft nicht berücksichtigt.

Vor Ort im Wallis dominiert der katholische Glaube und die dazugehörige Partei. Über jedem Ort hängen gut sichtbar riesige und mit Neonlichtern beleuchtete Kreuze. Bei Katastrophen wird oft von „unberechenbarer Natur“ oder „Naturkatastrophe“ gesprochen. Reichlich verklärend, denn der Klimawandel wurde ziemlich genau berechnet und die Erdöllobby ging bei der Verheimlichung auch ziemlich berechnend vor. DerKlimablog hat in diesem Beitrag die Region schonmal besucht und erklärt, wie genau die Wissenschaft Bescheid weiß, wie offensichtlich die Gefahren sind und wie die Prognosen lauten. Auch, dass man lokal bis vor kurzem noch traditionell gebetet hat, dass die Gletscher nicht weiter vorstoßen würden (ein Relikt aus der kleinen Eiszeit) und das jüngst mit Roms Segen auf Gebete gegen den Rückgang umgeschwenkt wurde. So, als ob nicht wir Menschen verantwortlich wären, sondern eben eine geistliche Kraft, der wir ausgeliefert seien. Warum sind dann in der Region trotzdem viele Verkehrswege, die in weltbekannte Luxusskiorte führen, extrem mit Radar, Sensoren, Lasern und Kameras vor Gefahren gesichert? Beim eigenen Haus und Verdienst hört die Schöpfungshörigkeit dann wohl eher am Gartenzaun auf.

Ein tragisches Zitat kommt ganz aktuell vom kantonalen Zuständigen für Naturgefahren, und zwar im Zusammenhang, wie man mit den immer noch drohenden weiteren Gefahren durch den Gletschersturz umgehen wolle. Er sagte, dass man sich nicht mehr auf Wahrscheinlichkeiten verlassen wolle, man habe damit gerade sehr leidvolle Erfahrungen gemacht. Vielleicht sollte das auch für seltsame Umstände gelten, dass in der Region Züge oft noch direkt parallel zu Straßen verkehren dürfen, während diese wegen akuten Gefahren oft schon geschlossen sind – was auch mit rechnerischen Wahrscheinlichkeiten begründet wird. Oft wird Wirtschaft gegen Gefahr aufgewogen. Alle Schutzmaßnahmen aus Beton oder Technik sind teuer und eigentlich nur Klimaanpassungsmaßnahmen. Richtiger Klimaschutz hingegen wird gerade immer günstiger. Da wäre das Geld primär besser angelegt. Dazu zählt auch Aufklärung und Information rund um das Thema.
Beispiele gibt es genug vor der Haustür und darüber hinaus. Letztes Jahr sind gleich ums Eck Menschen bei extremen Unwettern ums Leben gekommen und hoher Sachschaden ist entstanden (Saas Grund, Zermatt usw.). Im westlichen Kantonsteil ist ein Aluminiumwerk überschwemmt worden. Dort beziehen Zugbauer wie Stadler Aluminium für die Berliner U-Bahnen oder Porsche für ihre Autos – das führte zu einem Milliardenschaden und beim Zugbauer zu Gewinneinbrüchen, was wiederum das Werk in Berlin in wirtschaftliche Probleme brachte – ausbaden müssen es die Mitarbeiter. Die Firma hat im selben Jahr Schäden an drei Standorten infolge von Extremwettern in Spanien, Österreich und der Schweiz hinnehmen müssen. Stadler gehört ironischerweise übrigens einem Politiker dieser Partei (SVP), welche eben dem SRF Geld streichen will. Auch der amtierende Umweltminister der Schweiz, Albert Rösti, ist bei der Partei Mitglied. Er bringt es nicht fertig, auch nur ein Wort zum Klimawandel in diesen Tagen in die Mikrofone zu sagen. Liegt es daran, dass er vorher Öllobbyist für Swissoil war? Hinter vorgehaltener Hand wird er jedenfalls etwas abschätzig „Ölbert“ genannt. Pikantes Detail: Ebenjener ist auch gleichzeitig Medienminister und hat schonmal seine politischen Möglichkeiten noch vor der drohenden Halbierungsinitiative genutzt, denn die Rundfunkgebühr wurde bis 2029 gesenkt, weswegen SRF 17 % des Budgets einsparen und hunderte von Mitarbeiter entlassen sowie Sendungen einstellen muss – nur ein Vorgeschmack darauf, was bei einer Annahme der Initiative geschehen würde. Könnte man Zusammenhänge zwischen der hier zurückhaltend bis gehemmten medialen Berichterstattung über die Klimakatastrophe und diesem Muskelspiel eines fossilen, der Öllobby nahestehenden, Machtpolitikers vermuten?
Fazit
Warum verhalten sich ARD und SRF in derart schweren Momenten in Sachen Klimawandel so? Warum gerät der öffentliche Rundfunk so unter Druck in diesen Zeiten? Warum unternehmen wir und die Politik nicht mehr in Sachen Medienkrise? Denn diese hängt direkt mit der Klimakrise zusammen. Das sollte uns alle extrem besorgen. Das beide verbindende Element Demokratie ist genauso in Gefahr. Wir brauchen mehr Unabhängigkeit, mehr Geld, mehr Regulation gegen gierige und unethische Internetkonzerne, welche die Distribution guter Informationen stören, weniger Desinformation und mehr gute und gesicherte Information, wo kein Kontext weg gespart oder nur bestimmten Zielgruppen präsentiert wird. Jeder muss sich ein Bild machen können, was wirklich gerade mit unserem Planeten und den Menschen passiert. Und wenn man den Gletschersturz selber im Netz anschauen will, sollte man davor nicht all die Werbungen für Billigfleisch vom Discounter und Autoverkaufsplattformen wegklicken müssen. Wir alle müssen verstehen können und dürfen, dass wir nicht alleine sind und realisieren, dass laut Forschung eine schweigende Mehrheit für viel und drastischeren Klimaschutz besteht, diese das aber nicht im Geringsten so wahrnimmt. Auch oder gerade wegen der Medienkrise. Damit schließt dieser Beitrag, denn es wartet die Auflistung der neuesten weltweiten Extremwetterereignisse – gerade sind historische Regenfälle in Mumbai, zerstörerische Stürme in Austin, tödliche Fluten in Nigeria und außer Kontrolle geratene Waldbrände in Kanada aktuell. Außergewöhnlich viele Hurrikane und gefährliche Superzellen im gesamten mittleren Westen der USA sowie Zyklone in Indien sind zudem vorhergesagt – um nur einige zu nennen. Mehr zu den Ursachen dieser extremen Serie und die ganze Liste findest du hier.
Erscheinungsdatum: 1. Juni 2025